WerkBundStadt Berlin: Fortschritt durch Rückgriff
Auf einem ehemaligen Öltanklager im Berliner Westen will der Werkbund beispielhafte Wohnformen der Zukunft realisieren. Die WerkBundStadt bricht dabei mit großen Vorgängern und versucht, Traditionalisten und Modernisten in einem kollektiven Entwurfsverfahren zu einen.
Text: Thein, Florian, Berlin
-

Vor einem halben Jahr einigten sich 33 vom Werkbund handverlesene Architekturbüros auf das städtebauliche Konzept der sogenannten WerkBundStadt, einem dichten Quartier, das in Berlin-Charlottenburg entstehen soll.
Modell 1:200, Blick von der Quedlinburger Straße, Foto: Stefan Müller
Vor einem halben Jahr einigten sich 33 vom Werkbund handverlesene Architekturbüros auf das städtebauliche Konzept der sogenannten WerkBundStadt, einem dichten Quartier, das in Berlin-Charlottenburg entstehen soll.
Modell 1:200, Blick von der Quedlinburger Straße, Foto: Stefan Müller
-

Derzeit befindet sich an der Quedlinburger Straße, wo die WerkBundStadt entstehen soll, noch ein Tanköllager
Foto: WerkBundStadt Berlin
Derzeit befindet sich an der Quedlinburger Straße, wo die WerkBundStadt entstehen soll, noch ein
Tanköllager
Foto: WerkBundStadt Berlin
-
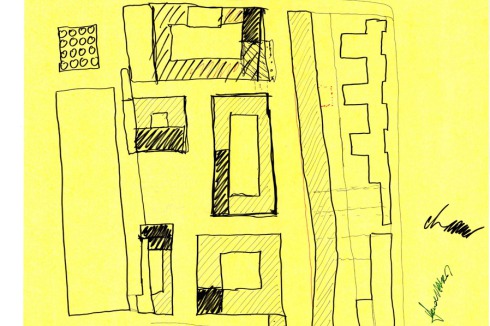
Die Skizze zu dem - von allen beteiligten Architekturbüros gemeinschaftlich entwickelten - städtebaulichen Konzept
Foto: WerkBundStadt Berlin
Die Skizze zu dem - von allen beteiligten Architekturbüros gemeinschaftlich entwickelten - städtebaulichen Konzept
Foto: WerkBundStadt Berlin
-
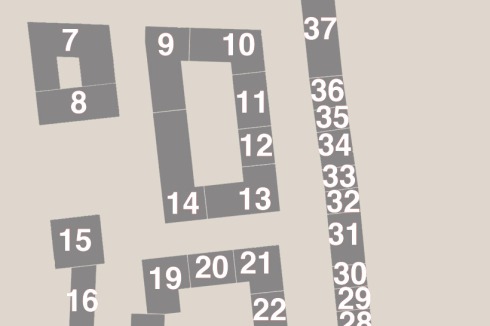
Der städtebauliche Rahmen wurde in 39 Parzellen unterteilt, von denen jeweils drei von einem Büro (teils auch in Partnerschaft) beplant wurden. In einem abschließenden Verfahren wurde aus den Vorschlägen für jede Parzelle ein Entwurf ausgewählt.
Grafik: Florian Thein
Der städtebauliche Rahmen wurde in 39 Parzellen unterteilt, von denen jeweils drei von einem Büro (teils auch in Partnerschaft) beplant wurden. In einem abschließenden Verfahren wurde aus den Vorschlägen für jede Parzelle ein Entwurf ausgewählt.
Grafik: Florian Thein
-

Parzelle 1: Hans van der Heijden Architect
Abb.: Architekten
Parzelle 1: Hans van der Heijden Architect
Abb.: Architekten
-

Parzelle 2: Schulz und Schulz Architekten mit bayer / uhrig Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 2: Schulz und Schulz Architekten mit bayer / uhrig Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 3: schneider + schumacher
Abb.: Architekten
Parzelle 3: schneider + schumacher
Abb.: Architekten
-

Parzelle 4: Heide & von Beckerath
Abb.: Architekten
Parzelle 4: Heide & von Beckerath
Abb.: Architekten
-

nps tchoban voss
Abb.: Architekten
nps tchoban voss
Abb.: Architekten
-

Parzelle 6: Christoph Mäckler Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 6: Christoph Mäckler Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 7: Patzschke Planungsgesellschaft
Abb.: Architekten
Parzelle 7: Patzschke Planungsgesellschaft
Abb.: Architekten
-

Parzelle 8: Office Winhov
Abb.: Architekten
Parzelle 8: Office Winhov
Abb.: Architekten
-
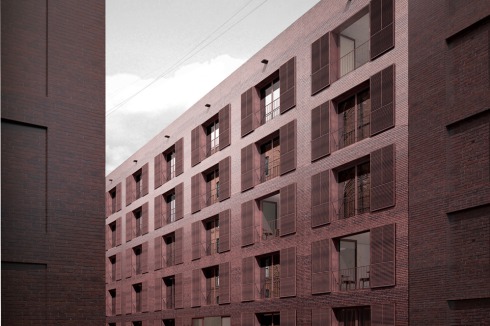
Parzelle 9: E2A
Abb.: Architekten
Parzelle 9: E2A
Abb.: Architekten
-
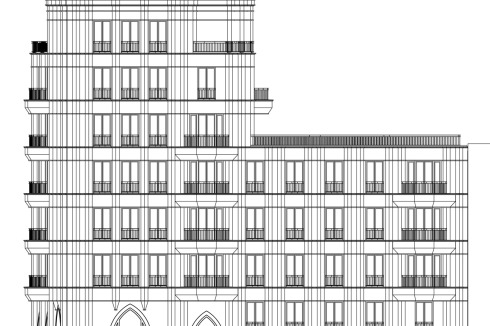
Parzelle 10: Nöfer Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 10: Nöfer Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 11: Thomas Kröger
Abb.: Architekten
Parzelle 11: Thomas Kröger
Abb.: Architekten
-

Parzelle 12: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 12: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 13: Modersohn & Freiesleben
Abb.: Architekten
Parzelle 13: Modersohn & Freiesleben
Abb.: Architekten
-

Parzelle 14: ingenhoven architects
Abb.: Architekten
Parzelle 14: ingenhoven architects
Abb.: Architekten
-

Parzelle 15: Dierks Sachs Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 15: Dierks Sachs Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 16: Bayer & Strobel Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 16: Bayer & Strobel Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 17: Uwe Schröder Architekt
Abb.: Architekten
Parzelle 17: Uwe Schröder Architekt
Abb.: Architekten
-

Parzelle 18: Studio di Architettura Lampugnani
Abb.: Architekten
Parzelle 18: Studio di Architettura Lampugnani
Abb.: Architekten
-
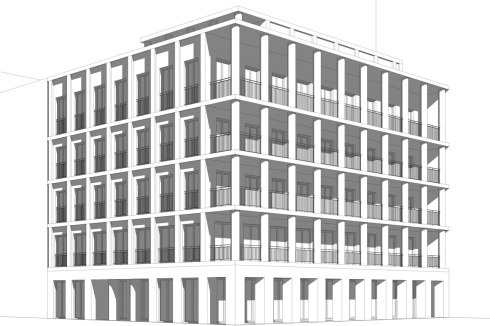
Parzelle 19: Rapp+Rapp
Abb.: Architekten
Parzelle 19: Rapp+Rapp
Abb.: Architekten
-

Parzelle 20: Klaus Theo Brenner
Abb.: Architekten
Parzelle 20: Klaus Theo Brenner
Abb.: Architekten
-

Parzelle 21: Kleihues+Kleihues
Abb.: Architekten
Parzelle 21: Kleihues+Kleihues
Abb.: Architekten
-

Parzelle 22: Weinmiller Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 22: Weinmiller Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 23: jessenvollenweider
Abb.: Architekten
Parzelle 23: jessenvollenweider
Abb.: Architekten
-

Parzelle 24: Staab Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 24: Staab Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 25: Prof. Hans Kollhoff Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 25: Prof. Hans Kollhoff Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 26: RKW Architektur und Städtebau
Abb.: Architekten
Parzelle 26: RKW Architektur und Städtebau
Abb.: Architekten
-

Parzelle 27: Klaus Theo Brenner
Abb.: Architekten
Parzelle 27: Klaus Theo Brenner
Abb.: Architekten
-

Parzelle 28: nicht zugewiesen
Parzelle 28: nicht zugewiesen
-

Parzelle 29: nicht zugewiesen
Parzelle 29: nicht zugewiesen
-

Parzelle 30: RKW Architektur und Städtebau
Abb.: Architekten
Parzelle 30: RKW Architektur und Städtebau
Abb.: Architekten
-

Parzelle 31: Brandlhuber+ mit June14
Abb.: Architekten
Parzelle 31: Brandlhuber+ mit June14
Abb.: Architekten
-
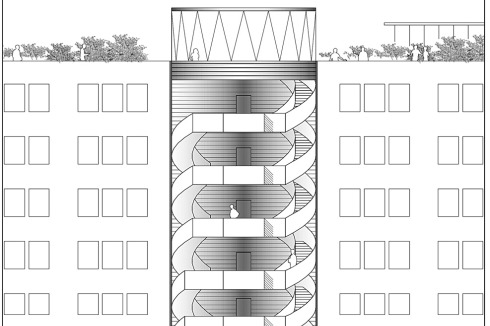
Parzelle 32: Lederer Ragnarsdottir Oei
Abb.: Architekten
Parzelle 32: Lederer Ragnarsdottir Oei
Abb.: Architekten
-

Parzelle 33: Weinmiller Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 33: Weinmiller Architekten
Abb.: Architekten
-
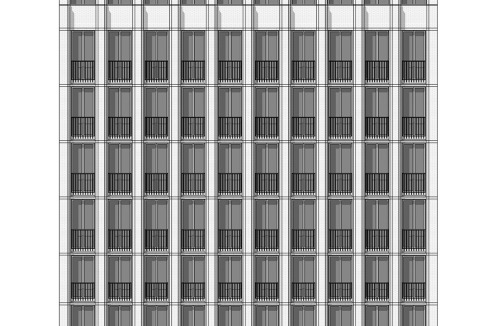
Parzelle 34: Caruso St John Architects
Abb.: Architekten
Parzelle 34: Caruso St John Architects
Abb.: Architekten
-
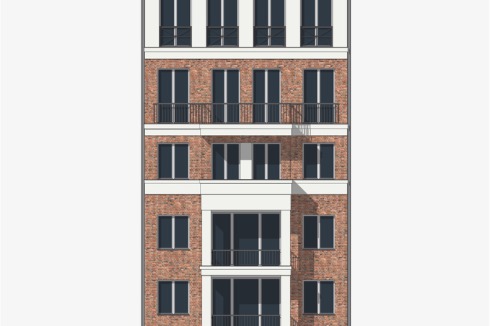
Parzelle 35: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 35: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 36: Max Dudler, wünscht keine Veröffentlichung des Entwurfs
Abb.: Architekten
Parzelle 36: Max Dudler, wünscht keine Veröffentlichung des Entwurfs
Abb.: Architekten
-
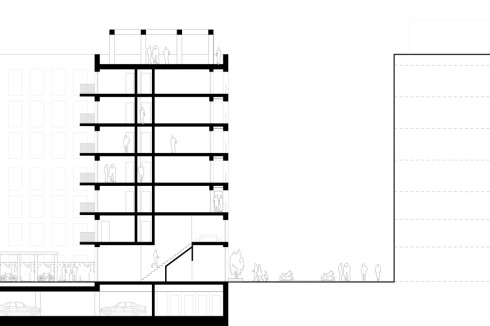
Parzelle 37: Bernd Albers Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 37: Bernd Albers Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 38: Cramer Neumann Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 38: Cramer Neumann Architekten
Abb.: Architekten
-

Parzelle 39: Hild und K Architekten
Abb.: Architekten
Parzelle 39: Hild und K Architekten
Abb.: Architekten
Ausgeschiedene Entwürfe
Foto: Florian Thein
Ausgeschiedene Entwürfe
Foto: Florian Thein
WerkBundStadt Berlin: Fortschritt durch Rückgriff
Auf einem ehemaligen Öltanklager im Berliner Westen will der Werkbund beispielhafte Wohnformen der Zukunft realisieren. Die WerkBundStadt bricht dabei mit großen Vorgängern und versucht, Traditionalisten und Modernisten in einem kollektiven Entwurfsverfahren zu einen.
Text: Thein, Florian, Berlin
Schon der Name WerkBundStadt macht deutlich, dass eine (Weissenhof-) Siedlung oder auch der „Würfelhusten auf der grünen Wiese“, so Werkbund-Bundesvorstand und Mitinitiator Paul Kahlfeldt, als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Stattdessen soll an der Quedlinburger Straße in Charlottenburg ein „dichtes, urbanes Quartier zum Wohnen, Leben und Arbeiten“ entstehen. Den von 17 Architekten geplanten 63 Wohnungen der Stuttgarter Weissenhofsiedlung (1927) stehen im direkten Vergleich 1100 Wohnungen gegenüber, geplant von 33 Architekten – bei nahezu gleicher Grundstücksgröße.
Wie genau die Auswahl jener 33 an der Planung beteiligten Büros erfolgte, die „die gegenwärtige Baukultur jenseits ästhetischer Tendenzen oder stilistischer Kriterien repräsentieren“, bleibt diffus. Einigen mag man eine eher historisierende, anderen eine eher progressive Handschrift zuordnen, aber derlei Lagerdenken scheint passé zu sein. In diskursiver Konsensbildung wurde gemeinschaftlich erörtert „wie wir wohnen wollen“.
In einem Werkstattverfahren kochten die handverlesenen Architekten zusammen am städtebaulichen Konzept für das derzeit noch mit zehn Öltanks bebaute Grundstück in Spreelage. Schlussendlich einigte man sich auf ein stark an der europäischen Stadt vor Neunzehnhundert orientiertes Rezept: fünf kleinere Blöcke, eine lange Reihe, ein zentraler Platz, verbunden durch schmale Straßen (Parken unerwünscht). Gewürzt wird das Gemeinschaftswerk durch die individuellen Entwürfe der Beteiligten für die jeweils mehreren Büros zugelosten Parzellen. Als es abschließend darum ging, aus 114 entstandenen Vorschlägen die zur Umsetzung bestimmten 39 Favoriten festzulegen, stieß man an die Grenzen einer diskursiven Einigung. Auch wenn man dem bisher beispiellosen Prozess einen großen Erfolg in der Konsensfindung attestieren muss, gelang eine Auswahl letztlich nur „durch Setzung seitens der Projektleiter“. Berücksichtigung fand dabei auch, dass kein teilnehmendes Büro leer ausging.
Vereint unter dem Backsteinmantel
Das beeindruckende Holzmodell des Quartiers, in dem die finalen Entwürfe präsentiert werden, offenbart eine erwartungsgemäß große Vielfalt. Der zweite Blick lässt jedoch eine Schnittmenge erkennen, die den expressiven Individualismus eint. Knappe zwei Drittel der Entwürfe weisen starke historische Anleihen auf, die zwischen Chicago School, Heimatschutzstil und postmoderner Ironie changieren. Die Zukunft des Wohnens wirkt bisweilen verdächtig alt.
Auch wenn die WerkBundStadt deutlich näher an den Siedlungen der Werkbund-Gründungszeit als an der antibürgerlichen Moderne der 1920er Jahre orientiert scheint, nehmen nicht alle Entwürfe historischen Bezug. Einige Nichttraditionalisten bleiben ihrer Haltung strukturell und formal treu, was am deutlichsten bei Ingenhoven, schneider+schumacher und Brandlhuber zu Tage tritt. Allzu gravierende optische Ausfälle wurden jedoch durch ein ebenfalls im Vorfeld beschlossenes Regelwerk verhindert. So muss jedes Haus in Backstein ausgeführt und „die konstituierenden architektonischen Elemente Sockel, Eingang, Fassade und Dach“ thematisiert werden. Leider stellt die Zwangsverziegelung nicht immer einen Zugewinn dar – so ist Ingenhovens begrüntes Quadratraster mit auskragenden Glaskuben in, nun ja, grünen Ziegeln ausgeführt und Brandlhubers aus vorangegangenen Projekten bekannte außenliegende Erschließung durch ein halbdurchlässiges, ornamentales Ziegelstrick verschleiert. Den materialgerechten Umgang mit Klinker leisten die Ziegelarchitekten dann doch überzeugender.
Begründet wird das Backsteinbekenntnis mit dem Genius Loci – Berlin sei nun mal Ziegelstadt, so Paul Kahlfeldt. Ob die sichtbare Ziegelfassade in Berlin tatsächlich eine solch stadtbildprägende Dominanz hat, mag man zögerlich hinterfragen. Dass der Genius Loci sich jedoch allein aus der den Ort umgebenden Materialität speist, greift zu kurz. Die noch vorhandene Industriearchitektur bietet genügend Anknüpfungspunkte zur interpretativen Spurensicherung. Mit der städtebaulichen Tabula Rasa wurde diese Chance leider vergeben. Einzig das noch vorhandene Wohnhaus an der Quedlinburger Strasse von 1910 wird erhalten, was wohl nicht zuletzt an der stilistischen Nähe zum zukünftigen Quartier liegen mag.
Wohnformen der Zukunft?
Die Abkehr von der suburbanen Siedlung seitens des Werkbundes ist nicht neu. Neu ist der strukturelle wie stilistische Rückgriff auf eine Zeit vor der Werkbundsiedlung. Die Negierung vorangegangener Konzepte gleicht einem systemischen Neustart. Die WerkBundStadt drängt nach den gescheiterten Anläufen in Neuss und München auf Realisierung. Mit der Kombination von Bekanntem bietet sie deutlich weniger Angriffsfläche für Stadträte als Kazunari Sakamotos Konzept für die letztlich gestoppte – ebenfalls innerstädtische – Münchner Werkbundsiedlung von 2007. Die WerkBundStadt will unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein Stück Stadt schaffen, nicht visionär, aber solide, und einem selbstbestimmten, recht konservativen Qualitätsanspruch genügend. Wie eine solche Positionierung in Zeiten der Internationalisierung, enormer Migrationsbewegungen, kultureller Diversität und Durchmischung zu deuten ist, bleibt da eher Randnotiz. Definitiv bescheinigen muss man ein hohes Vermarktungspotential. Das Konzept der käuflichen Stilsicherheit durch Altbewährtes und damit einhergehender Identitätsbildung geht in der Automobilbranche seit langem auf. Neuauflagen von Klassikern wie Käfer, Mini und Fiat 500 bedienen bürgerliche Sehnsüchte und garantieren hohen Absatz.
Ein zeitnaher Baubeginn der WerkBundStadt ist jedoch nicht zuletzt aufgrund der „an bezahlbarem Wohnraum orientierten“ Wohnungen zu begrüßen. Angestrebt sind 30% – so sie denn ins Konzept der zukünftigen Bauherren passen. Auch von politischer Seite besteht Wille zur Umsetzung, wie der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung Marc Schulte betont – nicht zuletzt auch um unliebsame Rotlicht-Einrichtungen wie „Heidis Kuschelecke“ endlich aus solch hervorragender Citylage zu verbannen.






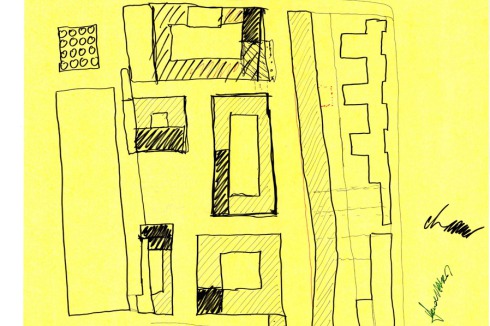
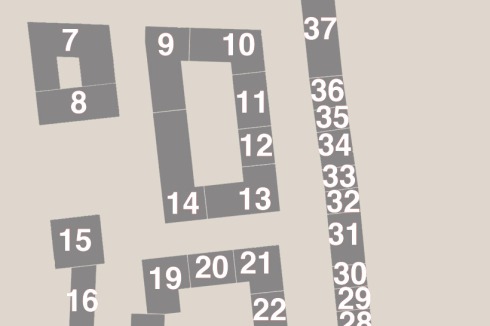








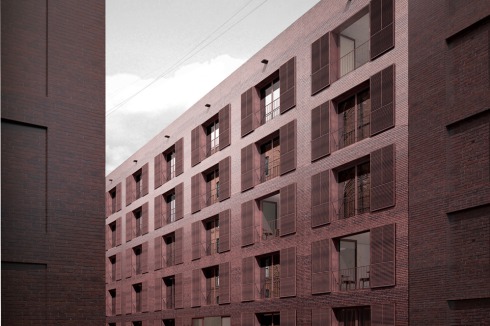
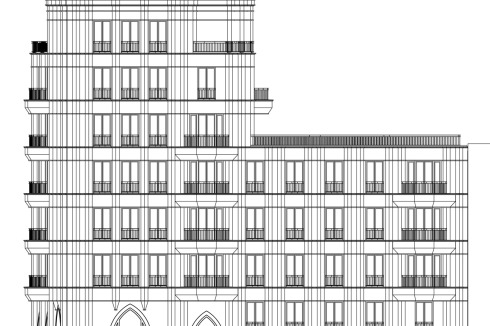








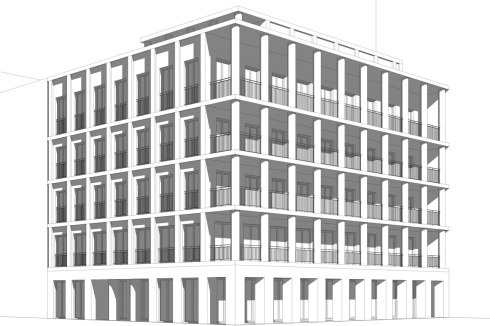











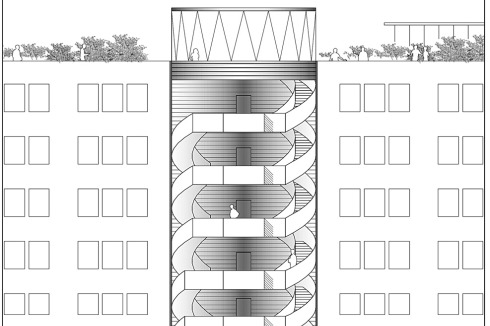

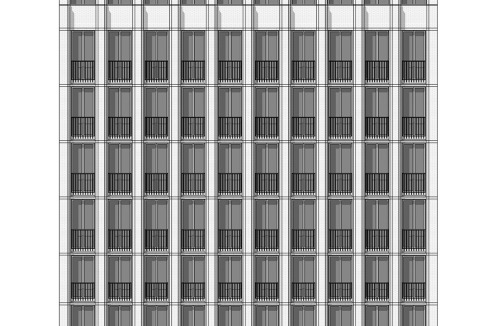
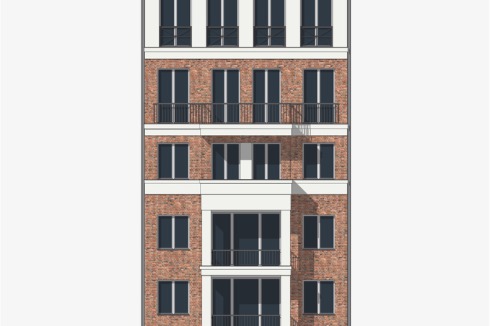
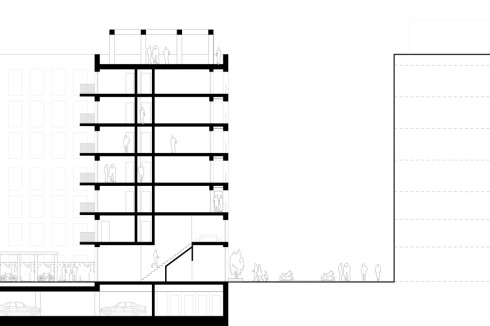






1 Kommentare