Sub-Urbanismus
Keine Wohnform hat sich in so kurzer Zeit so flächendeckend ausgebreitet wie das Einfamilienhaus, das nach 1945 in der westlichen Welt einen beispiellosen Siegeszug antrat. Inzwischen sind viele Siedlungen in die Jahre gekommen – und erfüllen weder die Bedürfnisse ihrer gealterten Bewohner noch die Anforderungen der neuen Generation. Verkommt der einstige Wohntraum zum Ladenhüter?
Text: Krisch, Rüdiger, Tübingen; Zeichnungen: Racine, Ross
Sub-Urbanismus
Keine Wohnform hat sich in so kurzer Zeit so flächendeckend ausgebreitet wie das Einfamilienhaus, das nach 1945 in der westlichen Welt einen beispiellosen Siegeszug antrat. Inzwischen sind viele Siedlungen in die Jahre gekommen – und erfüllen weder die Bedürfnisse ihrer gealterten Bewohner noch die Anforderungen der neuen Generation. Verkommt der einstige Wohntraum zum Ladenhüter?
Text: Krisch, Rüdiger, Tübingen; Zeichnungen: Racine, Ross
„Das eigene Haus ist der Mittelpunkt der Welt.“ In diesem Satz des amerikanischen Architekten Charles Moore steckt fast alles, was viele Menschen auch heute noch vom Einfamilienhaus träumen lässt. Der Traum von einer heilen Welt auf einem Stück Land, das einem niemand streitig machen kann, ist uns offenbar in tiefen Bewusstseinsebenen eingeschrieben, in denen auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstbestimmung verortet ist. Die Menschen erleben ihre Privatsphäre als Bollwerk gegen die schnellen, oft unkontrollierbaren Veränderungen der Welt „da draußen“, als Rückzugsraum gegen unerwünschte Fremdeinwirkung aller Art und als Ort für einen Wert, der in allen Studien ganz oben steht: Selbstverwirklichung.
Das Einfamilienhaus, frei stehend in einem umzäunten Garten, hält sich in Umfragen konstant als bevorzugte Wohnform der Deutschen – auch die viel zitierte neue Popularität des innerstädtischen Wohnens kann daran offenbar nicht rütteln. Wer diesen Traum als gesellschaftsfeindlich interpretiert, tut den Einfamilienhausgebieten unrecht und unterschätzt ihre sozialen Qualitäten. Die dort konsequent umgesetzte Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem ist auch für die Verfechter der klassischen Gebäudeblocks der „Europäischen Stadt“ ein wichtiges Argument.
Apropos „Europäische Stadt“: Wer liebt sie nicht, die pittoresken mittelalterlichen oder klassizistischen Innenstädte, die gründerzeitlichen Stadterweiterungen mit ihrer räumlichen Fassung, baulichen Dichte und gemischten Nutzung. Nur – es ist nicht jedermanns Sache, dort auch zu wohnen. Wir sitzen gerne im Sommer bis in den späten Abend auf der Terrasse unserer Stammkneipe – aber hätten wir auch gerne unser Schlafzimmer direkt darüber? Dann schwingen wir uns doch lieber ins Auto oder auf das Fahrrad und kehren zurück in die Ruhe unseres Hauses in der Vorstadt.
Nun nehmen die erwähnten Studien zu den Wohnwünschen erst nach und nach eine neue Generation in den Blick, über die zu lesen ist, sie wolle lieber teilen als besitzen, übernachte auf übers Internet vermittelten privaten Sofas und interessiere sich überhaupt nicht mehr für Statussymbole – schon gar nicht für Autos. Daraus ergeben sich Fragen: Wird das eigene Stück Land zukünftig noch wichtig sein? Wie bewege ich mich in die Vorstadt? Und insgesamt: Steuert der Typus Einfamilienhaus auf eine Krise zu?
Ein junges Phänomen
Im Gegensatz zu dörflichen Strukturen sind Einfamilienhausgebiete ein relativ junges Phänomen. Im Mittelalter hielt vor allem der Wunsch nach Sicherheit die Menschen in der umwehrten Siedlung. Sachliche Voraussetzung für das Wohnen in der Vorstadt war somit die Durchsetzung staatlicher Ordnung, räumlich erkennbar in der Schleifung der Festungsanlagen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die folgende planvolle Besiedelung des suburbanen Raums war ein gesellschaftsübergreifendes Phänomen: Als Prototypen gab es sowohl Villenkolonien – zunächst im Umfeld von Schlössern und Residenzen, später entlang von Bahnlinien rund um die Haltepunkte – als auch Arbeitersiedlungen in der Nähe großer Industriebetriebe, die oft dem in England entstandenen Idealtypus der Gartenstadt nacheiferten.
Auf diesen historischen Grundpfeilern trat das Einfamilienhaus im reinen, nutzungshomogenen Wohngebiet nach 1945 in der westlichen Welt – und nur von der ist hier die Rede – einen beispiellosen Siegeszug an, löste sich aber spätestens ab den 1950er Jahren von der Bindung an Arbeitgeber oder Trassen des öffentlichen Verkehrs. Vielmehr legten sich flächenhafte Wohngebiete, die zum überwiegenden Teil aus Einfamilienhäusern bestanden, in mehr oder weniger konzentrischen Kreisen um die Innenstädte, erschlossen durch breite Straßen, aber zunächst nur selten durch Busse oder Bahnen.
Die flächenhafte Entstehung von Einfamilienhaus-Siedlungen in „verstädterter Landschaft“ (Johann Jessen) ist ohne erhebliche Veränderungen im Aufbau der Gesellschaft und im Mobilitätsverhalten breiter Bevölkerungsteile nicht denkbar. Das Wachsen breiter Mittelschichten, das auf wirtschaftlichem Fortschritt und steuerlichen Förderungen fußte, ist die wohl wichtigste Grundlage des Booms der Wohnform in der Nachkriegszeit. Heute ist uns kaum noch bewusst, dass man in der Bundesrepublik bis zum Erlass des Wohneigentumsgesetzes im Jahr 1951 nur auf eigenem Grund und Boden im Eigentum wohnen konnte – Stockwerkseigentum war rechtlich nicht geregelt. Hinzu kommt die Rollenverteilung innerhalb der Kleinfamilie: Die nicht erwerbstätige Hausfrau, die sich in Vollzeit um Haushalt und Kinder kümmerte, lebte recht ortsfest und stellte keine allzu hohen Ansprüche an die Verkehrsgunst ihres Wohnorts. Parallel dazu sorgte der berufstätige Mann alleine für das Einkommen der Familie und nahm für das ruhige und sichere Wohnumfeld oft weite Wege zum Arbeitsplatz in Kauf. Erstmals entstand daraus ein breiter Bedarf für individuelle (Auto-)Mobilität, die man sich leisten können musste: Bedingung für die Entwicklung des Berufs-Pendelns zum Massenphänomen war, dass das Auto erschwinglich wurde – in Anschaffung und Betrieb.
Wachsen und Schrumpfen
Auch in ihrer städtebaulichen Entwicklung folgen die Einfamilienhaus-Siedlungen einfachen ökonomischen Grundregeln: So lässt sich am Zuschnitt und an der Größe der Häuser und Grundstücke das Alter des Wohngebiets ablesen. Nach einer einfachen Faustformel kann man so die Quartiere in der Reihenfolge ihrer Entstehung sortieren: Während sich im Laufe der Jahrzehnte die neuen Wohngebiete um die Innenstadt legten, schrumpfte die durchschnittliche Grundstücksgröße, während die Wohnfläche der darauf gebauten Häuser immer weiter anstieg (oder, in Planersprache: die Grundflächenzahl verhält sich umgekehrt proportional zum Alter der Siedlung). In Wohngebieten der Zwischenkriegszeit finden sich nicht selten Häuser mit 70 m2 Wohnfläche auf Grundstücken, die 1000 und mehr Quadratmeter groß sind (dies lässt sich meist mit dem politischen Ideal erkären, dass die Bewohner sich mit einer kleinen Landwirtschaft selbst versorgen). In der Nachkriegszeit bewegten sich die Zahlen langsam aufeinander zu und näherten sich zum Ende des 20. Jahrhunderts aneinander an: Häuser mit 200 m2 Wohnfläche auf Grundstücken unter 400 m2 sind um die Jahrtausendwende durchaus üblich.
Auf den Immobilienmärkten ist eine weitere Regel zu beobachten: Je jünger das Haus, desto mehr entspricht es den Bedürfnissen heutiger Kundenkreise. Welche/r Berufstätige will noch auf das eigene Arbeitszimmer verzichten, wenn er/sie es steuerlich geltend machen kann? Das macht bei heute weit verbreiteten Doppelerwerbs-Familien gleich zwei Räume, plus einen für jedes Kind (sofern im Lebensentwurf dafür Platz war). Zudem steigen die Ansprüche an die Privatsphäre innerhalb der Familie, und damit fast zwangsläufig auch die Wohnfläche. Und wer hat heute noch Zeit, sich um einen großen Garten zu kümmern? Von dessen Kosten bei Erwerb und Pflege mal ganz abgesehen... Andererseits sind die jüngeren, größeren Häuser üblicherweise weiter entfernt vom Zentrum und tragen die Hypothek des aufwendigen Pendelns mit sich herum. Ob sie daher langfristig besser marktfähig sind als ältere, meist zu kleine Häuser (denen die alten Bebauungspläne oft kaum Erweiterungspotenzial zubilligen) auf zu großen (und somit zu teuren) Grundstücken, bleibt abzuwarten.
Im Gegensatz zu den Mobilitätskosten kann man diesem Problem mit planerischen Mitteln zu Leibe rücken. Eine einfache Übung ist es, Möglichkeiten zu schaffen, kleine Häuser zu vergrößern, sei es durch Dachausbauten, Aufstockungen oder An- bzw. Erweiterungsbauten. Hier stößt man nur gelegentlich an das Limit der Grundstücke, viel häufiger an gestalterische Schmerzgrenzen: Wenn beispielsweise in Kleinhaus-Siedlungen der Zwischenkriegszeit die von den Bauherren gewünschten Erweiterungen doppelt so groß ausfallen wie das zu erweiternde Gebäude, gerät irgendwann das Siedlungsbild in eine prekäre Schieflage. Hier ist bei der Bauleitplanung Sensibilität gefragt, damit nicht mit der Maßstäblichkeit eine zentrale Qualität des Standorts verloren geht. Sofern sich das Problem der Zuwegung lösen lässt, kann es durchaus sinnvoll sein, die großen Grundstücke zu teilen und zusätzliche Baufenster auszuweisen. So entsteht Platz für verträgliche Nachverdichtung, was die Häuser wieder erschwinglich macht. Auch dabei muss man darauf achten, das Erscheinungsbild der Siedlung zu wahren, um nicht ihre Vorteile auf dem Altar der Ökonomie zu opfern – und damit mittelfristig auch diese zu gefährden.
Planer versus Bewohner
Um die Qualitäten und gestaltprägenden Eigenschaften eines Wohnquartiers zu sichern, muss einerseits der Gebietscharakter sorgfältig analysiert werden, andererseits müssen die bereits vorhandenen und erwartbaren Problemlagen klar beschrieben werden. Dabei herrscht zwischen Planern und Bewohnern meist große Einigkeit über die Stärken der Siedlungen aus den 50er und 60er Jahren: ihre gute Durchgrünung und die meist recht großzügigen öffentlichen Räume werden allgemein sehr positiv bewertet. Die im Erscheinungsbild häufig noch recht homogene Bebauung wirkt harmonisch – die Zeiten ungezügelter Individualität kamen später.
In Sachen Nutzung ist das Bild weniger einheitlich. Guten Noten für die Wohnqualität steht oft eine erhebliche Unzufriedenheit mit der gebotenen Infrastruktur gegenüber, da die kleinen Versorgungseinheiten vielerorts den Konzentrationsprozessen im Handel zum Opfer gefallen sind und Kindergärten wie auch Schulen aufgrund der Überalterung der Bevölkerung schließen mussten. Überhaupt ist die für urbane Quartiere erwünschte Nutzungsmischung in diesen Siedlungen nicht vorhanden – sie wird aber auch nicht erwartet und somit nicht vermisst.
Erstaunlich sind die Meinungen zum Thema Quartiersidentität. Die Planer diagnostizieren auf diesem Gebiet häufig Defizite, die von der Bevölkerung nicht wahrgenommen oder zumindest nicht negativ gesehen werden. Der Wiedererkennungswert der Siedlung innerhalb der Stadt und ihrer Abgrenzung zu benachbarten Gebieten, die Lesbarkeit der Quartierseingänge, auch das Vorhandensein eines für alle erreichbaren und attraktiven Treffpunkts – alles dies sind Kriterien, die im Blick von außen relevant sind, innerhalb der Siedlung aber niemanden interessieren. Wenn sie also fehlen, erscheint dies der planenden Zunft als Problem, während die Bewohnerschaft erklärtermaßen keinen Mangel leidet.
Dass sie keinen Wert auf Abgrenzung legt, ist für die Fachwelt nachvollziehbar und auch erfreulich. Was wirklich überrascht, ist die weitgehende Indifferenz gegenüber einem identitätsstiftenden Ort, an dem die Bewohner zusammenkommen können. Auf Nachfrage ist zu hören, dass es die nachbarschaftlichen Strukturen sind, die den Zusammenhang im Quartier herstellen: Begegnungen auf dem Weg zum Kindergarten, Gespräche über den Gartenzaun... Daraus erwachsen Wohlbefinden und soziale Verwurzelung, ohne dass dies nach außen erkennbar wird. Und wer nach Identifikation mit dem Wohnort sucht, steigt in den Bus oder das Auto, fährt ins Zentrum und trinkt den Cappuccino auf dem Marktplatz.
Aus Sicht der Nutzer sind es ganz andere Defizite, die das Leben in der Siedlung beeinträchtigen: am häufigsten wird hier erstaunlicherweise der Mangel an Parkraum moniert, meist verbunden mit der Klage über den flächig zugeparkten öffentlichen Raum, der dadurch sowohl für die Bewegung als auch den Aufenthalt, vor allem für spielende Kinder, nur eingeschränkt nutzbar ist. Diese Einschätzung teilen die zuständigen Behörden nur selten – sie wissen, dass es in neueren Siedlungen und urbanen Gebieten viel enger zugeht. Zusätzlichen Parkraum zu schaffen (und die vorhandenen, aber für andere Dinge genutzten Stellplätze und Garagen auf den privaten Grundstücken wieder ihrer Bestimmung zuzuführen) ist zudem nur selten umsetzbar, da die dafür erforderlichen Flächen im Privatbesitz sind. Aufwertende Maßnahmen für Straßen und Wege lassen sich meist nur dann finanzieren, wenn ohnehin Arbeiten an Versorgungsleitungen anstehen.
Am Ende bleibt, wie so oft, eine erhebliche Diskrepanz zwischen Innen- und Außenperspektive. Planer nehmen von außen Defizite wahr, die innen niemanden stören – und umgekehrt. Die Bewohner freuen sich in ihren Häusern und Nachbarschaften, die anderen fragen nach dem Mehrwert, den die Einfamilienhausgebiete dem städtischen Leben bieten könnten. Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist.
Ladenhüter Einfamilienhaus?
Wenn die suburbanen Siedlungen ihre Existenz den Umbrüchen im Mobilitätsverhalten und bei den Mobilitätskosten verdanken, liegt der Verdacht nahe, dass deren aktuelle Entwicklung ein erhebliches Zukunftsrisiko bedeutet: Die Kosten pro Kilometer Autofahrt steigen langfristig spürbar an und belasten stark die ökonomische Kalkulation des Wohnens im eigenen Haus. Dass dies bislang noch selten thematisiert wird, mag daran liegen, dass viele der betroffenen Häuser im Moment noch von der Generation ihrer Erbauer bewohnt werden, die nicht mehr im Berufsleben steht. Allerdings stellt sich für genau diese Altersgruppe akut die Frage, ob die Risiken und Nebenwirkungen des Wohnens im Haus vor der Stadt angesichts der steigenden Lebenserwartung und des hohen Pflege-Risikos auf Dauer zu beherrschen sind. In jedem Fall bringt der anstehende Generationswechsel die Marktfähigkeit der Wohnform auf die Agenda.
Ist die Zugkraft der Wohnform Einfamilienhaus so groß, dass auch Käufer aus der Generation Y den Zeit- und Kostenaufwand des Pendelns dafür auf sich nehmen werden? Wenn ja, werden sie zweifellos genau rechnen. Eine aktuelle Studie zu den Wohnkosten in und um Berlin belegt, dass das Wohnen im zentralen Stadtbereich trotz gestiegener Mieten dann günstiger ist, wenn man neben den eigentlichen Wohnkosten die realen Kosten der alltäglichen Mobilität (Besitz und Nutzung eines Autos oder/und ÖV-Fahrkarten) in die Gleichung einbezieht. Menschen mit knappem Zeit-Budget neigen auch dazu, den Zeitbedarf für den Weg von und zur Arbeit und den damit verbundenen Verlust an Lebensqualität gewissermaßen in die Gleichung „einzupreisen“.
Daraus ergibt sich eine weitere Frage, deren Bedeutung weit über das Ökonomische hinausweist: Wie wird sich die unvermeidliche Mischkalkulation aus Zeit und Geld auf den Wert der betroffenen Immobilien auswirken? Schon heute sind in Gegenden mit schrumpfender Bevölkerung Einfamilienhäuser außerhalb der Top-Lagen oft nur mit Verlust verkäuflich – insbesondere dann, wenn sie in Grundriss und Ausstattung sehr individuell auf die Bedürfnisse der Erbauer maßgeschneidert sind. Dabei bleiben manche Erwartungen der Eigentümer an die Immobilie als Teil ihrer Altersvorsorge auf der Strecke – aber auch der Optimismus für eine strahlende Zukunft, der einst den Bau dieser Häuser begleitet hat.
So treten die Probleme der älteren suburbanen Siedlungen immer deutlicher zutage. Manche Kommunen haben inzwischen allerdings erkannt, dass da auch erhebliche Potenziale schlummern, die sich mit planerischen Mitteln mobilisieren lassen: Sie erstellen städtebauliche Gutachten, Rahmenpläne und Entwicklungskonzepte, vielerorts werden auch alte Bebauungspläne überprüft und fortgeschrieben. Der Autor dieser Zeilen ist an einigen derartigen Projekten beteiligt und schreibt mit dem Blick aus der Praxis. Diese Prozesse erweisen sich – wie alles Planen im Bestand – meist als zeitaufwendig und anstrengend. Wenn sie den Bestand sichern und seine Qualitäten stärken, sind sie jedoch die Mühe wert.






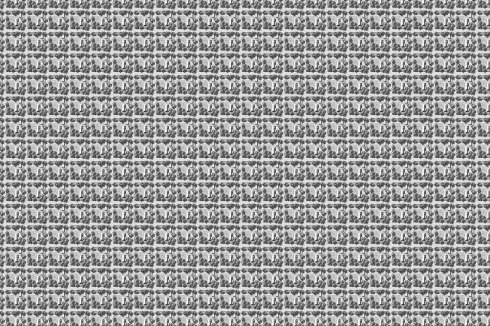



0 Kommentare