Wohin gehört die Königinmutter Idia?
Vor der Eröffnung des Ethnologischen Museums im Berliner Humboldt Forum ist eine Diskussion zur Form der Präsentation und zur möglichen Restitution wichtiger Werke entbrannt.
Text: Bodenstein, Felicity, Berlin
Wohin gehört die Königinmutter Idia?
Vor der Eröffnung des Ethnologischen Museums im Berliner Humboldt Forum ist eine Diskussion zur Form der Präsentation und zur möglichen Restitution wichtiger Werke entbrannt.
Text: Bodenstein, Felicity, Berlin
Vor vier Jahren bezog Horst Bredekamp, einer der Gründungsintendanten des Berliner Humboldt Forums, in einem Interview Stellung zur öffentlichen Kritik an der künftigen Institution. Damals gingen Aufrufe zu einer Restitution von Teilen der noch in Dahlem befindlichen Sammlungen über Proteste aus der interessierten Öffentlichkeit und einzelner Akteure gegen ein postkoloniales Erbe nicht hinaus. Auch in den akademischen Kreisen von Anthropologen und Kunsthistorikern war nicht mehr als ein gedämpftes Raunen der Empörung in Bezug auf die Planungen für das künftige Museum zu vernehmen. Als visuellen Aufmacher für das Interview zeigte man ein Rendering zur geplanten Aufstellung der Benin-Bronzen: Der makellos weiße Raum der musealen Präsentation entrückte die Objekte maximal von jeglicher äußeren Wirklichkeit ab. Im Vordergrund steht eines der berühmtesten Stücke aus der etwa 580 Objekte umfassenden Dahlemer Benin-Sammlung, die Bronzebüste der Königinmutter Idia aus dem 16. Jahrhundert.
Der Portraitkopf, als eines der herausragenden Stücke der Sammlung prominent präsentiert, ist zugleich das allgegenwärtige Gesicht auf den Protestplakaten der Kampagne „No Humboldt 21!“, die mit dem Slogan „Schon Beutekunst betrachtet?“ die Öffentlichkeit aufrütteln wollte. Im Interview sagt Bredekamp Sätze wie „Werke sind nicht bezähmbar“ und er erläutert, wie die Objekte der Sammlung nicht auf derartige Forderungen zu reduzieren seien, sondern für sich selbst sprechen müssten: „Vor allem dürfen die aus den damaligen Kolonien stammenden Werke nicht automatisch mit dem Kolonialismus kurzgeschlossen werden“. Dieser frühe Schlagabtausch kann durchaus als Messlatte dafür dienen, wie sich die Debatte seither entwickelt hat, und er bietet sich als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen an, wie sich die nächsten Etappen darstellen könnten. Mittlerweile fällt es schwer, die Frage der kolonialen Provenienz auszuklammern, ebensowenig wie sich Rückgabe-Anfragen der Herkunfts-Ethnien ignorieren lassen. Die Benin-Skulptur, zunächst von Britischen Marine-Soldaten erbeutet, wurde 1900 in London für 31 Pfund verkauft. Die Büste stammt vermutlich vom Schrein der Königinmutter, wo sie gemeinsam mit mehreren ganz ähnlichen Portrait-Büsten aufgestellt war, die heute in Museumssammlungen überall auf der Welt zu sehen sind. Im Museum in Benin City im heutigen Nigeria steht dagegen nur eine Gipskopie des Kopfes aus dem British Museum, welches die Büste als Schenkung direkt erhielt, und die vielleicht vom selben Künstler stammen könnte, wie auch der Berliner Idia-Kopf. Fest steht, dass beide keinesfalls als solitäre Schaustücke gedacht waren, sondern Teil einer Erinnerungskultur mit einer Vielzahl von Figuren als Repräsentationen von verehrten Ahnen. Vor dem Jahr 1897 waren solche Stücke in Europa nicht einmal bekannt. Am 21. Februar 1897 – so im offiziellen Expeditionsbericht dokumentiert – wurde der Palast der Königinmutter zielgerichtet und systematisch zerstört. Die Berliner Büste scheint die Spuren des damaligen Geschehens zu tragen, in der massiven Bronze-Hülle klafft ein großes Loch. Da der Schaden an der Rückseite der Büste entstand, bliebt die ästhetische Anmutung des Objektes dennoch unversehrt. Für historisch kundige Betrachter steht das Objekt für die absichtsvolle Zerstörung religiöser Schauplätze in Benin und im Süden von Nigeria. Die Plünderung des Palastes der Königinmutter war Teil eines umfassenden Geschehens, welches sich in zahllosen, wenn auch deutlich weniger bekannten, Vorfällen ungehemmter Zerstörung niederschlug. Die örtlichen Glaubensinhalte und religiösen Praktiken galten als moralisch verwerflich und unvereinbar mit der freien Entfaltung ökonomischer Kreisläufe, der hauptsächlichen Motivation für derartige militärische Interventionen. Ein Forschungsprojekt am Humboldt Forum zu Kriegstrophäen aus Deutsch-Ostafrika, die vor allem während des Maji-Maji-Aufstands durch die deutschen Truppen erbeutet worden waren, hat jetzt vergleichbare Abläufe belegt.
Im Zusammenhang mit solchen historischen Diskursen wirkt es zunehmend problematisch, die Autonomie des Objekts zu postulieren und durch die neutralisierende Wirkung des „white cube“ zu unterfüttern. Eine derart unsensible Herangehensweise, wie sie in den frühen visuellen und programmatischen Vorschlägen für das Humboldt Forum noch allgegenwärtig ist, war einer der Hauptgründe für den im Laufe der konzeptionellen Planungsphase immer lauter werdenden Protest, den alle Anstrengungen im Rahmen des Humboldt Labs zu einer kritischeren Haltung gegenüber Präsentation und Forschung zu finden, nicht aufhalten konnten. Bislang gibt es wenig Anzeichen dafür, dass sich dies abschwächen könnte, im Gegenteil: Zu erwarten sind ähnlich kontroverse Reaktionen wie 2006 am Pariser Quai Branly oder im Dezember letzten Jahres bei der Wiedereröffnung des Afrikamuseums in Tervuren.
Bisher präsentierte Modellansichten zur Architektur und Innenausstattung des Humboldt Forums gelten vielen als wenig geeignete Raumvisionen für eine Präsentation der „Welt“-Sammlungen - wobei „Welt“ durchaus auch als Euphemismus für die einst kolonialisierten Teile des Globus verstanden werden darf. Einigen Anteil daran hat wohl die Tatsache, dass sich Einlassungen zur Architektur des Forums auffallend oft nach einer Art historischem Revisionismus mit Mut zur Lücke anhören: Das fast schon penetrante Insistieren auf einer „präkolonialen“ Tradition der Kunstkammer am ehemaligen Ort im Schloss lässt sich wohl bestenfalls als etwas verunglückte Rechtfertigung für eine „Rückführung“ des Schlosses zu einer wie immer gearteten „ursprünglichen“ Funktion verbuchen. Mit etwas weniger Wohlwollen ist das darin enthaltene Ablenkungsmanöver unverkennbar. Immerhin hat die überwältigende Mehrheit aller Objekte aus dem Berliner Ethnologischen Museum rein gar nichts mit der Kunstkammer zu tun, sondern wurde in der Hochzeit des europäischen Kolonialismus zwischen 1870 und 1930 erworben. Die Zahlen sprechen für sich: 200 Objekten aus der Kunstkammer stehen zehntausende Objekte der kolonialistischen Ära gegenüber. Allein die Afrika-Sammlung schwoll zwischen 1880 und 1914 von 3.500 auf 55.000 Objekte an. Die Strategie, ausschließlich auf eine ganz spezifische Phase aus der Sammlungsgeschichte zu fokussieren, ist aus dem konzeptuellen Ansatz der im Jahr 2000 in der restaurierten Bibliothek König George III eröffneten „Enlightenment Gallery“ des British Museums hinlänglich bekannt. „Universale“ Ambitionen der Sammlung werden damit betont, während heiklere Fragestellungen etwa hinsichtlich späterer kolonialer Erwerbspolitik ausgeklammert bleiben.
Indem die Architektur als Referenz auf eine Epoche fungiert, in der die Neugier auf fremde Kulturen scheinbar unproblematisch war, erzeugt der Bau als solcher eine willkommene und wohlfeile Distanz zu jeglicher Assoziation mit den 34 Jahren deutscher Kolonialherrschaft. Jüngste Vorschläge zu einem „Raum der Stille“ für ein Gedenken an Verbrechen wie den Genozid an den Herero und Nama treffen daher eher auf Skepsis, hier werde ein neuer Puffer zwischen die historischen Anliegen, die der Sammlung als solcher inhärent sind, und den Fragen der Provenienz geschoben, heißt es.
Im Zusammenhang einer Neuordnung ethnografischer Sammlungen traten architektonischer Stil und bauliches Substrat in jüngster Zeit häufiger als instrumentalisierter Teil einer „kuratierten Lesart“ von Geschichte auf. So in Paris, wo man beschloss, die Sammlung des Museums für die Kunst Afrikas und Ozeaniens (MAAO, Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie) in einen Neubau von Jean Nouvel umzuziehen, was im Umfeld der Eröffnung des Musée du Quai Branly hitzige Debatten auslöste (Bauwelt 28-29.2006). Die Grundlage für das 1960 gegründete MAAO bildeten die Sammlungsbestände des 1931 für die Pariser Kolonialausstellung errichteten „Palais de la Porte Dorée“. Die Neupositionierung im Herzen der touristischen Pariser Innenstadt hat zur Folge, dass die Besucher die Objekte nun nicht länger in jenem kolonialen Gebäude erleben; man entgeht der allegorisch verbrämten Wucht des 1930 entstandenen Skulpturenfrieses, mit dem Architekt Albert Laprade in opulenten visuellen Referenzen das Mutterland Frankreich und die ehemaligen Kolonien feiert. Der Nouvel-Bau ist das Aus für den vielschichtigen Interpretationsrahmen der Architektur, die die Sammlung über vier Jahrzehnte hinweg in den breiteren geopolitischen Kontext wirtschaftlicher kolonialer Ausbeutung gestellt und hierüber ein tieferes Verständnis für die Herkunft der Sammlung bewirkt hatte. Ohne fokussierte Maßnahmen gegen das traditionelle, also quasi „originale“ Selbstverständnis des Hauses wird auch das Humboldt Forum – ganz wie Quai Branly, und allen Anstrengungen aus den Humboldt Labs um fortschrittliche Initiativen mit eigens ins Leben gerufenen wissenschaftlichen Forschungsprojekten zum Trotz – den bisherigen Anfängen verhaftet bleiben: den ungeschickten Versuchen, unbequeme Aspekte der Geschichte entweder umzudeuten oder auszublenden.
Auch künftig wird diese Grundhaltung jegliche Handhabe der Architektur konterkarieren, über eine innovative Präsentation und kluges Management der Sammlungen zu einem neuen Bezug zur Vergangenheit zu finden. In letzter Zeit stoßen Aufrufe zur Restitution auf eine deutlich breitere Akzeptanz in der deutschen Debatte, jetzt erkennt man darin eine notwendige Geste, die durchaus auch im eigenen Interesse sein kann und etwa den bis dato allzu zögerlichen Ansatz der Institution gegen die Vorherrschaft des Ästhetischen in den Fokus rückt. Ebenso geht es um die Kernfrage nach der isolierenden und abschottenden Qualität des Gebäudes, die in krassem Widerspruch zum in den anfänglichen Planungen des Humboldt Forums formulierten Konsens über ein „Teilen“ von Kulturerbe steht.
Es wird Zeit brauchen, viel Zeit, um festzustellen, was zurückgegeben werden soll, welche Länder oder ethnische Gemeinschaften welche Ansprüche geltend machen und wie damit umzugehen ist. 2020 werden zumindest Teile der Benin-Sammlung als Leihgaben nach Benin City gehen, allerdings blieb bislang weiterhin offen, ob die Idia-Büste mit von der Partie sein wird, oder gar, ob der königliche Hof in Benin City die Leihgaben-Politik überhaupt als akzeptable Lösung auf Dauer anerkennen kann. Bereits jetzt zeichnet sich innerhalb und außerhalb der Museen in Deutschland wie der Herkunftsländer eine große Bandbreite von Positionen ab, denen zunächst einmal Gehör zu verschaffen ist.
Vom referenziellen Rahmen der Frühen Neuzeit und den damit verknüpften Begriffen von „Wissen“ und „Neugierde“, welcher ja auch über die Architektur etabliert werden sollte, ist der Diskurs inzwischen weit abgerückt: Ab jetzt steht die Sammlung als solche im Fokus.
Aus dem Englischen von Agnes Kloocke





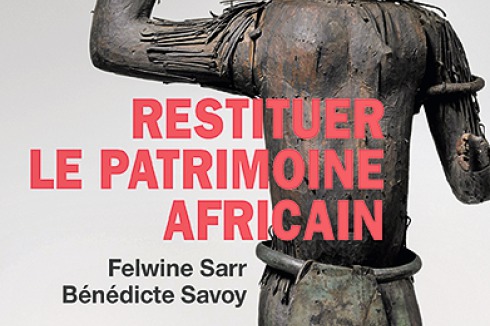



0 Kommentare