Wer definiert die Standards und zu welchem Zweck?
Ein Gespräch mit Charlotte Malterre-Barthes über Immobilienspekulation, Diskursstrategien, den Wert von Architektur und das Potenzial der Pause
Text: Stumm, Alexander, Berlin
Wer definiert die Standards und zu welchem Zweck?
Ein Gespräch mit Charlotte Malterre-Barthes über Immobilienspekulation, Diskursstrategien, den Wert von Architektur und das Potenzial der Pause
Text: Stumm, Alexander, Berlin
Frau Malterre-Barthes, Sie haben die Initiative „Global Moratorium on New Construction“ co-initiiert. Worum geht es?
In meiner Forschung setze ich mich seit Längerem mit der Extraktion von Rohstoffen auseinander, die entweder direkt für die Produktion von Baumaterialien oder indirekt für die Energiegewinnung benötigt werden. Es geht also um die jeweils konkreten materiellen Grundbedingungen eines Gebäudes und um die globale Klimakrise. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass der Bausektor für über vierzig Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Unterhalb eines hauchdünnen, rhetorischen Furniers von „Nachhaltigkeit“ operiert die Industrie weiterhin mit massivem Ressourcen- und Energiebedarf, für welche die Umwelt zerstört wird.
Zu Beginn des ersten Lockdowns in der Covid-19-Pandemie zirkulierte ein Questionnaire von Bruno Latour in den Postfächern vieler Akademiker. Er stellte die These in den Raum: „Wenn alles gestoppt wird, kann alles in Frage gestellt, umgeformt, selektiert, sortiert, für immer unterbrochen werden.“ Nur der Bausektor kam als eine der wenigen Branchen nie zum Erliegen. Die Forderung unserer Gruppe ist ein Moratorium, und – um Missverständnissen vorzubeugen – handelt sich demnach um ein zeitlich begrenztes Instrument: die Aussetzung der Bauaktivitäten für vielleicht sechs Monate oder ein Jahr.
Mir ist klar, dass dieser Aufruf für viele eine Provokation ist – das ist Absicht! Verschiedene Akteure, die bisher jede Verantwortung von sich gewiesen haben, fühlen sich angegriffen und im Zugzwang Stellung zu beziehen. Sie müssen sich vielleicht zum ersten Mal ernsthaft mit einem System Architektur auseinandersetzen, das in weiten Teilen auf Ausbeutung basiert. Die Initiative ist insofern ein Trojanisches Pferd.
Über Klimafragen wird in der Architektur seit einigen Jahren ernsthaft diskutiert, Konzepte wie „Reuse, Reduce, Recycle“ scheinen im Mainstream angekommen. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich unterstütze solche Konzepte, die auch in der Schweiz beispielsweise von „baubüro in situ“ vorangetrieben werden. Darüber hinaus gibt es Initiativen wie Klimastreik oder „Countdown 2030“, die sich aktiv für ein biodiversitäts- und klimagerechtes Bauen einsetzen. Es wird viel diskutiert, doch in den meisten Architekturbüros ist der Ansatz meines Erachtens immer noch ein Nischenphänomen. Industrie und Politik haben noch längst nicht begriffen, wie weitreichend der Wandel sein müsste. Abriss und Neubau, in der Schweiz euphemistisch Ersatzneubau genannt, ist weiterhin die Norm, deshalb der radikale Ansatz mit dem Moratorium.
Wie können wir die Zeit des Moratoriums sinnvoll nutzen? Sarah Nichols schlägt zum Beispiel vor, den Bestand zu sichten. Wenn wir genau wissen, was da ist und in welchem Zustand, können wir mit dem Vorhandenen viel besser arbeiten.
Stichwort Politik: Die EU hat im vergangenen Jahr die Renovierungswelle als wichtigen Teil des Green Deal in Gang gebracht. Sie will Millionen von Häusern mit Wärmedämmung ausstatten. Tut sich nicht doch etwas?
Gebäude nicht neu zu bauen, sondern zu sanieren, ist sicherlich die richtige Richtung, auch in Bezug auf die Energiefrage. Aber die von der EU angepeilten Ziele sind bisher in vielen Teil nicht klar ausformuliert. Letztlich ist die Idee immer die Gleiche, nämlich Neues hinzuzufügen. Welche Materialien kommen bei der Wärmedämmung zum Einsatz – Stroh oder andere lokal verfügbare, nachwachsende Ressourcen wohl eher nicht, sondern auf Erdöl basierende Schaumstoffe, die zu weiteren extraktiven Praktiken führen.
Außerdem geht es um eine weitere, sehr sensible Grundsatzhaltung: Vielleicht brauchen wir im Winter auch nicht immer eine in jedem Zimmer auf 24 Grad wohltemperierte Wohnung, sondern ziehen uns einfach einen Pullover an. So ließe sich Energie viel leichter einsparen. Bevor nun der Vorwurf kommt, ich wolle anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben – ich will darauf hinaus: Wer definiert die Standards und zu welchem Zweck?
Damit sind wir bei der Sozialen Frage. Zementieren wir mit einem globalen Moratorium nicht die ungleichen Machtstrukturen, insbesondere wenn wir an den Globalen Süden denken?
Ich verstehe die Kritik am „Globalen“ des Moratoriums. Wir als reiche Industrienationen sind moralisch nicht in der Position anderen Ländern vorzuschreiben, aus ökologischen Gründen mit dem Bauen aufzuhören. Wir haben schließlich selbst Jahrhunderte lang die Umwelt zerstört. Mich stört daran die dahinterstehende, oftmals nicht hinterfragte Maxime: Wachstum. Er wird zu einem Segen stilisiert, der allen Menschen zu Gute kommt. Das Moratorium ist aus einem weiteren Grund global: Der Extraktivismus wird in weiten Teilen von multinationalen Konglomeraten aus den Industrienationen vorangetrieben und basiert auf neokolonialen Praktiken. Für die eigene Profitmaximierung werden Menschen und Umwelt gerade in fragilen Staatengebilden ausgebeutet, weil sich Gesetze hier leichter aushebeln lassen. Stets wird dabei ein seit Kolonialzeiten wiederkehrender Topos heruntergebetet, nämlich der damit einhergehende wirtschaftliche Fortschritt für die „unterentwickelten“ Länder. Diese Praktiken des Extraktivismus müssen aufhören.
Trotzdem: Würde ein globales Moratorium nicht den Bau informeller Siedlungen befördern und damit Armut verschärfen?
Das Moratorium zielt auf privatwirtschaftliche Immobilienunternehmen ab. Selbstinitiierter Hausbau, der dem unmittelbaren Schutz dient, ist davon nicht betroffen. Wir wollen diesen Menschen also keinesfalls ihr Recht auf Wohnen absprechen. Diese Entwicklungen würden aber durch das Moratorium nicht befördert, denn sie sind von der Immobilienwirtschaft ohnehin immer schon ausgeschlossen.
In Ägypten zum Beispiel ist Wohnungsnot ein großes Problem. Die Regierung baut gerade eine neue Hauptstadt mit Unmengen Zement in derWüste, obwohl es in Kairo schon jetzt 12 Millionen leer stehende Wohneinheiten gibt, wie die ebenfalls am Projekt beteiligten Omar Nagati und Beth Stryker recherchiert haben. Es handelt sich um Spekulationsobjekte. Wenn Wohnraum nicht den Menschen zur Verfügung gestellt wird, die ihn dringend brauchen, sollten wir über Leerstandsgesetze und die Umverteilung von Reichtum diskutieren. Es geht um Politik und um Gerechtigkeit, für autoritäre Regime eine unbequeme Diskussion. Neue Wohnungen sind hier also nicht zwingend die Lösung.
In vielen anderen Fällen ist der dringende Bedarf an Infrastruktur aber real, und es wäre rundheraus rassistisch dies abzustreiten. Die Lage wird dadurch verkompliziert, dass in vielen informellen Siedlungen kapitalistische Strukturenlängst Einzug gehalten haben. Formell und informell lässt sich nicht mehr scharf trennen. Es bedarf deshalb einer genaueren Analyse der jeweiligen Umstände vor Ort. Die Idee eines „Globalen Südens“ als einheitliche Sphäre greift zu kurz.
Sie sind Assistant Professor in Harvard. Ist die Initiative ein elitäres Projekt?
Der Aufruf ist nicht gerade der Beliebteste an der Universität. Ich instrumentalisiere gewissermaßen den guten Ruf der Institution und nutze ihre große Reichweite, um die Diskussion voranzutreiben. Letztlich weise ich auch auf Mechanismen der Ausbeutung hin, in die die großen akademischen Institutionen selbst verstrickt sind. Unsere Gruppe ist kein verschworener Zirkel. Das Projekt ist ein work-in-progress und offen für viele Stimmen.
Wir wollen einen möglichst breiten demokratischen Prozess in Gang bringen. In der Schweiz existiert ein politisches System, in dem auch überkomplexe Fragestellungen direkt abgestimmt wird. In Zürich zum Beispiel wird seit Jahren zu jedem neuen Infrastrukturprojekt generell mit Ja votiert. Viele Stimmen schaffen es dabei nicht, sich Gehör zu verschaffen.
Ein Beispiel?
Es geht nicht zuletzt darum, wie Fragen gestellt werden. Wer würde ernsthaft den Bau einer neuen Schule ablehnen? Wenn man jedoch die größeren Zusammenhänge betrachtet und sieht, dass der Schulbau Konsequenz einer Neubausiedlung privater Investoren ist, wird es schon komplizierter. Wie gesagt: Es ist notwendig, genau hinzusehen. In einer demokratischen Debatte wird man Kritik einstecken müssen und es gibt Leute, die dagegen sind – das bekommen wir gerade sehr zu spüren!
Neben Kritik erleben wir aber auch viel Zuspruch. Viele Architekturschaffende kommen
auf uns zu und berichten, dass sie mit der eigenen Profession hadern und der Aufruf ihre eige-nen Zweifel an der aktuellen Situation artikuliert.
auf uns zu und berichten, dass sie mit der eigenen Profession hadern und der Aufruf ihre eige-nen Zweifel an der aktuellen Situation artikuliert.
Die eigene Profession hadert. Ist das nicht auch ein Problem der Ausbildung an den Universitäten? Muss sich die Architekturlehre ändern?
Es gibt meines Erachtens schon ein gewisses Bewusstsein an den Universitäten, dass sich die Pädagogik ändern muss. Insbesondere die Studierenden selbst fordern Themen wie Bauen im Bestand, Klimagerechtigkeit und die Erweiterung der sehr eurozentrischen Inhalte ein. Gerade die Kernbereiche tun sich damit aber schwer, das Patriarchat ist stark verwurzelt. Wichtige Fragen im akademischen Bereich sind für mich: Wer lehrt und was wird gelehrt? Es geht um mehr Diversität, aber auch darum, welche Referenzprojekte als gute Architektur mitgegeben werden.
Das modernistische Projekt und Ideen von Tabula Rasa, Neuheit und Fortschritt sind vielerorts noch immer das Maß aller Dinge. Beim Entwurf haben Studierende auf wundersame Weise immer alle Materialien zur Verfügung, Fragen der Rohstoffgewinnung werden suspendiert. Das trifft übrigens auch auf die Werkzeuge zu, die wir täglich nutzen. Beim Öffnen des CAD Programms erscheint immer erst ein leeres Raster. Ich sage nicht, dass in der Lehre alles über den Haufen geworfen werden muss, aber es bedarf der Kontextualisierung und der Erweiterung.
Wir müssen unsere Werte neu austarieren?
Genau! Nehmen wir das Konzept der Neuheit. Es ist sehr positiv besetzt. Instandhaltung und Pflege dagegen nicht so sehr. Das sieht man auch daran, dass diese Tätigkeiten oftmals von marginalisierten Bevölkerungsgruppen verrichtet und schlecht bezahlt werden. Von der Care-Arbeit bis zur Gebäudereinigung zeigen sich rassifizierte und genderbezogene Ungleichgewichte.
Menna Agha, die ebenfalls am Projekt beteiligt ist, hat den schönen Satz gesagt: „We need to stop construction in order to start building.“ Wir sollten offene Gemeinschaften konzipieren und neue Wege beschreiten, wie gebaute Umwelt geschaffen werden kann. An dieser Stelle möchte ich das niederländische Projekt Tabula Scripta von Floris Alkemade, Michiel van Iersel und Jarrik Ouburg erwähnen. Sie sehen Tabula Rasa als keine tragfähige Option mehr und legen den Fokus auf die bestehenden Qualitäten des städtischen und sozialen Gefüges.
Ein anderes Projekt, an dem Sie selbst beteiligt sind, ist „Non-Extractive Architecture. On Designing without Depletion“. Die Ausstellung ist gerade im V-A-C in Venedig zu sehen und wird begleitet von einer Publikationsreihe. Der Initiator Joseph Grima von Space Caviar spricht bei heute praktiziertem Bauen von „Cheap Architecture“, aber er sieht auch die Möglichkeit, dass Architektur ohne Raubbau an Mensch und Natur möglich ist.
Joseph Grima greift hier die Idee von Jason Moore auf, der den Begriff der „Cheap Nature“ geprägt hat. Zusammen mit Raj Patel hat Moore 2018 das Buch „A History of the World in Seven Cheap Things. A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet“ verfasst. Die sieben „billigen” Dinge, die sie ansprechen, sind Natur, Geld, Arbeit, Pflege, Nahrung, Energie und Leben. So lange all dies günstig zu haben ist, wird es für die Akteure innerhalb des kapitalistischen Systems immer mit einem Wegwerfcharakter verbunden sein.
Das Gegenteil von „Cheap Architecture“ ist, wie Grima selbst sagt, aber eben keine „teure“ Architektur, die sich nur die happy few leisten können. Wir sind hier beim Kern der Frage um die Werte von Architektur angekommen. Es geht darum, andere Kategorien zu etablieren, anhand derer Architektur wertgeschätzt wird.
In „Non-Extractive Architecture“ werden auchverschiedene Lösungen vorgeschlagen, die auf technologischen Entwicklungen aufbauen. Hier bin ich jedoch skeptisch. Dieser „Techno-Fix“ geht einher mit intensiver Nutzung und Abhängigkeit von Sekundär-Technologie. Er bringt damit eine neue Runde der Rohstoffausbeutung in Gang. Schon heute ist das Bauen auf ein komplexes technologisches System angewiesen: Das geht los mit Computern und Rechenzentren und endet bei GPS gesteuerten Prozessen beim Abbau von Materialien. Ein „Mehr“ ist nicht die Lösung. Technologie wird uns nicht retten.
Charlotte Malterre-Barthes ist Assistenzprofessorin für Urban Design an der Graduate School of Design der Harvard University. Sie promovierte 2018 an der ETH Zürich, ein Jahr später war sie Co-Kuratorin der 12. Internationalen Architekturbiennale von São Paulo. 2009 gründete sie mit Noboru Kawagishi OMNIBUS, eine Urban Design Agentur. Als Gründungsmitglied der Parity Group, einem Basisverband innerhalb der ETH, setzt sie sich für mehr Gerechtigkeit an Schule und Beruf ein. 2020 gründete sie zusammen mit Benjamin Groothuijse die Parity Front, eine Spin-off-Institution, die sich dem Aufbau solidarischer Netzwerke für Gleichberechtigung in der Architektur widmet. In Zusammenarbeit mit b+ um Arno Brandlhuber startete sie in diesem Frühjahr den Aufruf für ein „Global Moratorium on New Construction“ und organisiert Diskussionen und Veranstaltungen, in der kollektiv diskutiert wird, wie die Baubranche zu einem Halt gebracht werden kann. Bisher fanden die Roundtables „Stop Construction?“, „Pivoting Practices“, „Non-Extractive Design“ und „Seeking Policy“ statt, weitere sollen folgen.





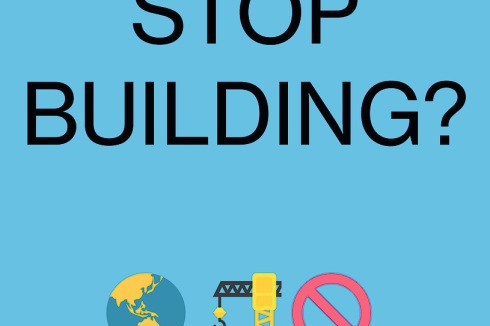






0 Kommentare