Stein gegen Stein | Architektur und Medien im geteilten Berlin 1950–1970
Text: Scheffler, Tanja, Dresden
Stein gegen Stein | Architektur und Medien im geteilten Berlin 1950–1970
Text: Scheffler, Tanja, Dresden
Durch die Einleitung mit ihren umfangreichen Fußnoten, die sich mit Berlin als Schauplatz des Kalten Krieges beschäftigt, muss man sich durchkämpfen. Der Hauptteil des Buches lässt sich dagegen gut lesen. Die Imageproduktion und Selbstbespiegelung auf beiden Seiten der Mauer war eklatant. In der DDR diente das Thema Architektur und Städtebau zur Inszenierung einer „Schein“-Öffentlichkeit, die im Alltag jedoch oft als Propaganda empfunden wurde. Die West-Berliner Medien berichteten oft auf niedrigem Niveau und thematisierten Baumängel oder Stadtgrün. Trotz des immer stärker werdenden Filzes zwischen Politik und Baubranche forderte schon damals Ulrich Conrads, Chefredakteur der Bauwelt, nachdrücklich Mitspracherechte für Architekten im Planungsprozess ein.
Nicht nur die Wechselbeziehungen zwischen Stalinallee (der heutigen Karl-Marx-Allee) und Hansaviertel werden dargestellt, sondern auch einige pikante Details der Systemkonkurrenz. Auf das direkt an der Mauer gelegene Hochhaus des Axel-Springer-Verlages reagierte das Politbüro der SED mit der als Sichtbarriere fungierenden Hochhausbebauung an der Leipziger Straße. Die Zeitung „Neues Deutschland“ stellte dagegen vor allem den 361 Meter hohen Fernsehturm als Gegenprojekt dar: „Er ist Axels Ärgernis Nummer eins, weil wir dann nicht nur moralisch, sondern auch tatsächlich viel höher sitzen als er. Aus dem sich drehenden Café werden die Leute herunterzeigen: Sieh mal, dort drüben, dort unten ist die Springersche Entenfarm.“
Bereits in den 50er Jahren begann mit der von einer riesigen Medienkampagne begleiteten Diskussion um den Wiederaufbau der Gedächtnis-Kirche („Wahrzeichen Berlins weicht starrem Beton“) die Kritik am Verlust des „alten Berlin“. Der Foto-Essay-
Band „Die gemordete Stadt“ (1964) von Wolf Jobst Siedler und Elisabeth Niggemeyer entwickelte sich durch die geschickt fotografierten Bildmotive – belebte Straßen- und Hinterhofszenen des alten Berlin im „Zille“-Stil werden menschenleere Straßenräume der Neubaugebiete gegenübergestellt – zu einem Bestseller der Kritik am Nachkriegs-Städtebau.
Bei der Dynamik der Proteste gegen die Abrisssanierung lassen sich immer wieder Parallelen in Ost und West entdecken. Fernseh-Berichte über eine spontane Hausbesetzung nach einem Konzert der Rockband „Ton Steine Scherben“ machten die Kreuzberger Szene schlagartig bekannt. Für den Erfolg des DEFA-Films „Die Legende von Paul und Paula“, der den Abbruch eines historischen Wohnquartiers für ein innerstädtischen Neubaugebietes zeigt, sorgte u.a. auch die Musik der Puhdys, die sämtliche Abrissszenen untermalt.
Da die Architektur der Nachkriegszeit den städtischen Raum stark prägt und nach wie vor umstrittenist, erscheint diese Publikation zum richtigen Zeitpunkt. Im Spannungsfeld von „Architektur und Massenmedien“ ist noch viel Forschungsbedarf. Stephanie Warnkes Studie zu den im Kalten Krieg liegenden historischen Wurzeln der alten (und neuen) Leitbilder leistet dazu einen Beitrag.








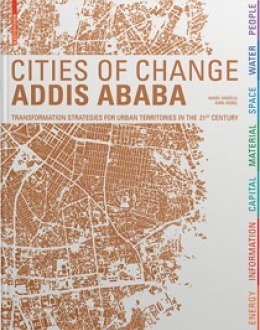

0 Kommentare